
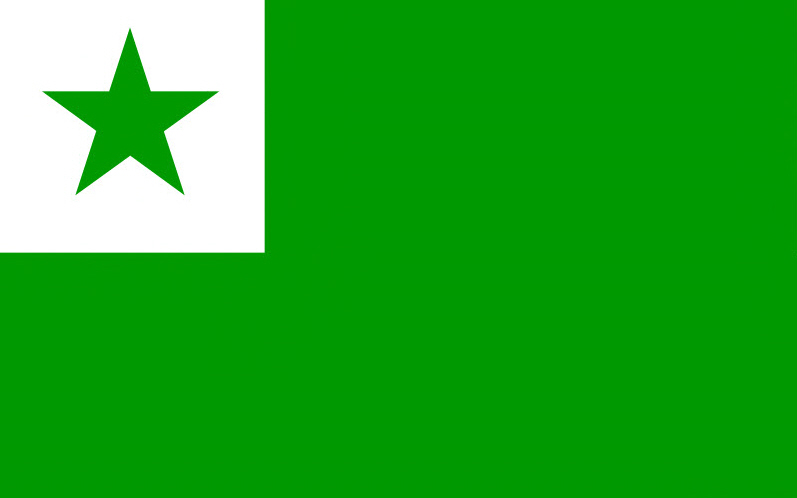

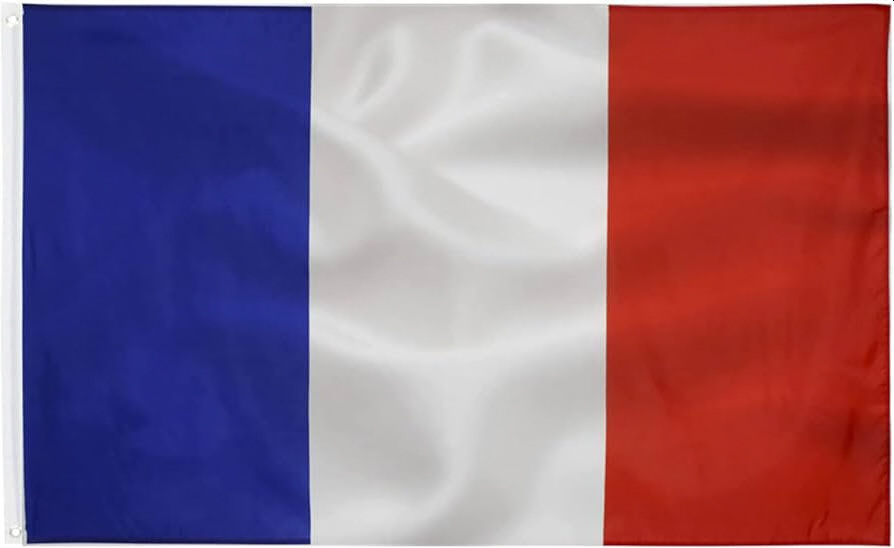






 | 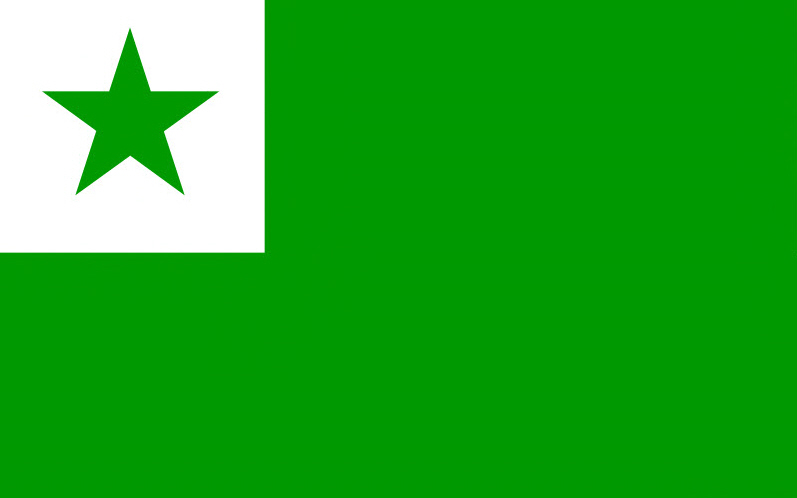

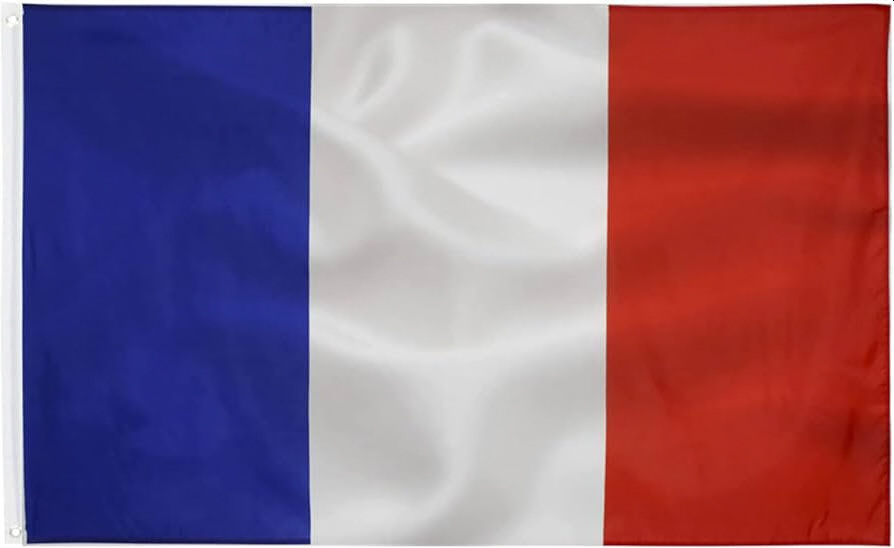






|
Die jüngste Veränderung im Papstamt hat den Vatikan erneut in den Mittelpunkt der weltweiten Medienaufmerksamkeit gerückt. Über Wochen hinweg berichteten die Medien ununterbrochen über den Konklaveprozess und die persönlichen Eigenschaften des neuen Pontifex. Doch diese Medienflut hat tiefere und dringendere Fragen in den Hintergrund gedrängt: Wie wird Autorität in der katholischen Kirche ausgeübt? Welche Rolle spielen die Gläubigen in ihrer Organisation? Und inwieweit spiegelt diese Struktur den Geist des Evangeliums wider, das sie zu vertreten beansprucht?
Die Art und Weise, wie die Medien den Übergang im Papstamt behandelt haben, verdeutlicht einen beunruhigenden Trend: die Banalisierung der Debatte über das institutionelle Modell der Kirche. Es wurde eifrig spekuliert, ob der neue Papst ein Reformer oder Traditionalist sei, ob er aus dem globalen Norden oder Süden komme, ob er einen freundlichen oder eher doktrinären Stil habe. Doch die eigentliche, grundlegende Frage wurde weitgehend ausgeklammert: die strukturell undemokratische und ausgrenzende Natur des derzeitigen kirchlichen Systems.
Im 21. Jahrhundert operiert die Kirche weiterhin nach einer hierarchischen und vertikalen Logik, die die große Mehrheit ihrer Mitglieder von Entscheidungsprozessen ausschließt. Laien – insbesondere Frauen – haben nach wie vor keine echte Stimme oder Mitsprache in jenen Gremien, in denen pastorale, theologische und institutionelle Richtungen bestimmt werden. Der Zugang zur Macht ist ausschließlich dem geweihten Klerus vorbehalten – in einer Struktur, die nicht auf gemeinsame Verantwortung, sondern auf Gehorsam ausgelegt ist.
Dieses Modell ist nicht nur anachronistisch im Vergleich zu anderen sozialen Organisationen, die repräsentative und partizipative Formen der Governance angenommen haben, sondern steht auch in direktem Widerspruch zur Ekklesiologie des Zweiten Vatikanischen Konzils, das die Idee des Gottesvolkes als aktive Teilnehmende am Leben der Kirche wiederentdeckt hat. Dennoch wurde diese konziliare Einsicht systematisch durch einen institutionellen Apparat behindert, der mehr daran interessiert ist, Macht zu bewahren, als sie zu erneuern.
Dieses hierarchische Modell ist nicht spontan entstanden. Es war das Ergebnis jahrhundertelanger institutioneller Konsolidierung, in deren Verlauf die Kirche zunehmend Merkmale annahm, die weit entfernt waren von der Bewegung Jesu. In diesem Prozess wurde der prophetische und befreiende Kern des Evangeliums allmählich an den Rand gedrängt, zugunsten einer Struktur, die auf Kult, Liturgie und doktrinärer Kontrolle fokussiert ist. Die Rolle des Klerus wurde absolut gesetzt – als exklusive Mittler zwischen Gott und dem Volk – während die christliche Gemeinschaft zu einem passiven Publikum wurde, das von der transformativen Praxis des Reiches Gottes entfernt blieb.
Über weite Strecken ihrer Geschichte widmete die Kirche mehr Energie der Bewahrung äußerer Formen – Rituale, Feierlichkeiten, liturgische Normen – als der Verkörperung der frohen Botschaft für die Armen, der Gerechtigkeit für die Ausgeschlossenen oder der prophetischen Anklage gegen unterdrückende Mächte. Diese Hypertrophie kultischer Aspekte gegenüber den gemeinschaftlichen und missionarischen lastet weiterhin schwer auf jeder authentischen Erneuerung. Die Erinnerung an Jesu befreiendes Projekt und dessen Wiederaneignung sind eine notwendige Voraussetzung für jeden ernsthaften Versuch einer kirchlichen Reform.
Noch beunruhigender ist, dass diese rigide Struktur unter einem vermeintlich göttlichen Legitimationsanspruch verteidigt wird, der kirchliche Macht als unantastbar und unangreifbar darstellt. Doch das Evangelium bietet eine radikal andere Vision von Autorität. Jesus übte keine herrschende Macht aus, sondern trat als Diener auf: „Wer der Erste sein will, soll der Letzte von allen und der Diener aller sein“ (Markus 9,35). In seinem Umgang mit den Ausgegrenzten, seiner Kritik an den religiösen Autoritäten seiner Zeit und seiner Weise, Gemeinschaft zu schaffen, relativierte Jesus jede Form von Autorität, die nicht dem Gemeinwohl dient.
Die Treue zur Botschaft des Evangeliums kann keine kirchliche Struktur legitimieren, die Macht in einer klerikalen Elite konzentriert, die Vielfalt der Charismen ausschließt und Frauen systematisch marginalisiert. Vielmehr verlangt sie eine tiefgreifende Transformation hin zu einem Kirchenmodell, in dem Autorität wirklich repräsentativ ist und als Dienst – nicht als Privileg – ausgeübt wird.
Die Masse der Gläubigen schwankt ihrerseits zwischen Resignation und vorsichtiger Hoffnung. Viele spüren, dass es nicht ausreicht, auf einen „guten Papst“ oder einen zugänglicheren Stil zu hoffen. Es geht um etwas viel Tieferes: darum zu erkennen, ob die Kirche bereit ist, die Konsequenzen des Evangeliums, das sie verkündet, anzunehmen und die Machtstrukturen zu überdenken, die ihre volle Verwirklichung verhindern.
In demokratischen Gesellschaften nehmen Katholikinnen und Katholiken aktiv an politischen Prozessen teil, in denen sie Rechte, Stimme und Einfluss haben. Doch innerhalb ihrer eigenen Kirche werden dieselben Bürgerinnen und Bürger wie Untertanen behandelt, ohne effektive Mitwirkungsmöglichkeiten bei Entscheidungen, die ihre Glaubensgemeinschaft betreffen. Dieser Widerspruch schreit nach Auflösung. Wie lange noch werden wir diese kirchliche Ausnahme hinnehmen, die den Gläubigen verweigert, was ihnen in anderen Lebensbereichen als gerecht anerkannt wird?
Der Wechsel im Papstamt sollte Anlass sein, über diese Fragen tiefgehend nachzudenken. Es handelt sich nicht um eine nebensächliche oder bloß organisatorische Angelegenheit. Es ist eine theologische, evangeliumsgemäße und pastorale Frage. Können wir weiterhin eine Machtstruktur verteidigen, die weder die Botschaft Jesu widerspiegelt noch die Würde der Gläubigen achtet? Können wir weiterhin eine Reform aufschieben, die seit Jahrzehnten von großen Teilen des Gottesvolkes gefordert wird?
Es steht nichts Geringeres auf dem Spiel als die Glaubwürdigkeit der Kirche selbst und ihre Fähigkeit, das Evangelium in einer Welt zu verkörpern, die lebendige, offene und mitverantwortliche Gemeinschaften braucht. Vielleicht ist es an der Zeit, aufzuhören, auf Veränderungen von oben zu warten – und stattdessen von unten her eine Kirche aufzubauen, die ihren Ursprüngen treuer ist und sich von den Lasten institutionalisierter Macht befreit.
